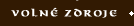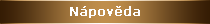
Pro zobrazení seznamu příspěvků zvolte sekci v horním menu.
|
Johann Georg Wilhelm Pape (* 3. I. 1807 Berlin — † 23. II. 1854 Berlin) Johann Georg Wilhelm Pape, Dr. namhafter Lexikograph, geboren zu Berlin am
3. Januar 1807, † daselbst am 23. Februar 1854. Pape kam in früher
Jugend nach Culm in Westpreußen, wo sein Vater, nachdem er als Soldat
dem Vaterstande treue Dienste geleistet, eine kleine Austellung an dem dortigen
Kadettenhause erhalten hatte; daselbst erhielt Pape auch den ersten Unterricht.
Das Interesse, welches die Lehrer und der Leiter der genannten Anstalt an dem
Knaben nahmen, gab ihm Belegenheit seine trefflichen Anlagen zu entwickeln,
und er fand an einen Herrn v. Scheliha einen wohlwollenden Bönner, der
ihm seine persönliche Unterstützung und Fürsprache zuvendete,
so daß Pape 1820 zu seiner weiteren Ausbildung nach Berlin gesendet in
die Untertertia des Gymnasiums zum grauen Kloster eintreten konnte. Hier macht
Pape bei unermüdlichen Fleiße unter den Leitung eines Bellermann,
Fischer, Giesebgrecht, Heinsius, Köpfe, Stein undanderer Männer
so rasche und treffliche Fortschritte, daß er schon an Ostern 1825 als
Selectaner und Primus omnium das Gymnasium absolvierte und die Berliner
Universität bezog, wo er sich dem Studium der Theologie und Philologie
widmete. Angeregt durch Boeckh's, Lachmann' und Bernhardy's Vorträge
wandte Pape sich indessen bald mit steigender Vorliebe ganz der classicher
Philologie zu, bestand nach Beendigung des akademischen Trienniums das Examen
pro facultate docendi und trat sodann 1828 als Candidatus probandus
in das Lehramt an dem Gymnasium zum grauen Kloster ein. Schon nach Verlauf der
ersten Hälfte seines Probejahres wurde Pape durch Köpfe, welcher die
außerordentliche didaktische Befähigung desselben erkannte, zum
Collaborator befördert. Eine wissenschaftliche Arbeit, seine Lectiones
Varronianae, ewarb ihm1829 in Halle die philosophische Doctorwürde; ein
Jahr später wurde Pape zum ordentlichen Lehrer und am 31. Juli 1837 zum
Professor an dem erwähnten Gymnasium ernannt, eine rasche, aber der
Würdigkeit der Leistungen Pape's entsprechende Laufbahn. — Neben
einer sehr anstrengenden und mit äußerster Pflichttreue
geführten Lehrthätigkeit fand Pape noch Zeit und Kraft zu
hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen, die in ihrer Art umfassende
und andauernde Studien erfordern; Pape wandte seine Thätigkeit mit
Reigung und Erfolg dem Gebiete der Lexicographie zu. So erschien von ihm
1836 zuerst sein Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache,
sodann 1837 ein Programm de inveniendis Graecae linguae radicibus,
Arbeiten, die von gründlichster Forschung zeugen. Sein Hauptwerk,
Griechisch-deutsches Handwörterbuch, erschien 1842, das als ein
wesentlicher Fortschritt im Fache der Lexicographie zu bezeichnen ist und schon
1849 und 1850 eine zweite Auflage erfordete; diesem Werke hatte Pape
gleichzeitig ein eigenes Wörterbuch der griechischen Eigennamen
beigegeben, das besonders in der Neugestaltung, die es durch G. E. Benseler
erhalte hat (2 Bde., Braunschweig 1863—70), als eine sehr dankenswerthe
Ergänzung des Passow'schen Werkes betrachtet werden muß. Hieran
schloß sich sein 1845 erschienens Deutsch-griechisches Wörterbuch
zum Schulgebrauch, das mannigfache kritische Anfechtungen insbesondere von
V. Chr. Fr. Rost erfuhr, das aber ebenso wie das Griechisch-deutsche
Wörterbuch, zumal nach den von M. Sengebusch geschehenen Bearbeitungen,
sich als treffliches Hilfsmittel im Gebrauche erhalten und bei manchen Mangel
im Einzelnen auch seine bedeutenden Vorzüge hat. — Diese
umfängliche wissenschaftliche und litterarische Thätigkeit beeinträchtigte
aber keineswegs Pape's Wirksamkeit als Lehrer; mit der Gediegenheit seines
Wissens und mit einer vortrefflichen Lehrmethode verband Pape eine fromme,
sittlich ernste, liebevolle Gesinnung, die ihren Einfluß auf die ihn
umgebende Jugend übte, ferner eine wissenschaftliche Gründlichkeit,
die sich seinen Schülern mittheilte, und eine seltene Hingabe an seinen
Beruf, die ihn zuletzt noch bei schwerem körperlichen Leiden, das ihn
zum Gehen unfähig machte, den Unterricht bis drei Wochen vor seinem Tode
fortsetzen ließ. Zu Anfang des Jahres 1852 hatten sich die Anfänge
eines Rückenmarkleidens bei Pape gezeigt, das rasch in bedenklicher Weise
zunahm und das, wiewohl zwei Jahre lang hin und wieder einige Hoffnung auf
Genesung vorhanden schien, doch schließlich mit solcher Heftigkeit sich
steigerte, daß er ihm 48. Lebensjahre erlag. Chronik des Gymnasiums zum grauen Kloster in Berlin, Programm, Jahrg. 1854; S. 36. — Heindl, Biographien der ber. u. verdienstv. Pädagogen und Schulmänner, S. 348 ff. — Geschichte der classichen Philologie in Deutschland von C. Bursian. Zweite Häfte, S. 757 Binder Allgemeine Deutsche Biographie, "Ovens ~ Philipp", Bd. 25, Leipzig 1887, pp. 138–139. Bibliografie: Další odkazy: Friedrich August Eckstein, Nomenclator Philologorum, Teubner, Leipzig 1871, I 930, 433–434. W. Konner, Gelehrtes Berlin im Jahre 1845, Berlin 1846. |
|
Gustav Eduard Benseler (* 28. II. 1806. Freiberg — † 1. II. 1868 Freiberg) Gustav Eduard Benseler, Philolog, Sohn eines Schriftsetzers, geb. 28. Febr. 1806 in Freiberg im sächsischen Erzgebirge, † 1. Febr. 1868. Nachdem er durch Stundengeben sich die Mittel verschaft hatte, das Gymnasium seiner Vaterstadt zu vollenden, bezog er 1824 die Universität Leipzig, um unter der Leitung Gottfried Hermann's Philologie zu studieren. 1831 kam er als Hülfslehrer nach Freiberg zurück und rückte am Gymnasium bis-zum ordentlichen Lehrer der Quarta vor. Der politischen Bewegung des Jahres 1848 schloß er sich mit allem Feuer an; seine hinreißende Gabe in der freien Rede brachte ihn an in die Spitze des Freiberger Vaterlandsvereins; hierauf zum Abgeordneten gewählt, entwickelte er mit seinem Freunde Heubner eine große Thätigkeit bei Einsetzung der provisorischen Regierung in Dresden. Nach Niederwerfung des Aufstanders wurde Benseler, da er den Plan einer Flucht nach Amerika nicht ausführen konnte, in Freiberg verhaftet und nach zweijähriger Untersuchungshaft zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurtheilt; die Hingebung seiner Frau erwirkte jedoch eine Milderung der Strafe auf sechs Jahre Arbeitshaus. Er satz zwei Jahre in Zwickau, wo er neben anderen litterarischen Arbeiten den Isokrates übersetzte, bis es endlich den rastlosen Bemühungen seiner treuen Gattin gelang, ihm wieder die Freiheit zu erringen. Da verschiedene Versuche, sich eine Stelung im Auslande zu verschaffen, ohne Erfolg waren, siedelte er 1855 nach Leipzig über, wo er fern von aller politischen Thätigkeit einen eisernen Fleiß, um durch litterarische Arbeiten und Stundengeben sich und den Seinigen ein anständiges Auskommen zu schaffen. — Als Schrifsteller erwarb sich Benseler viele Verdienste um die griechischen Redner durch seine Bearbeitungen des Isokrates (zuerst Areopagiticus, 1882, gesammte Textausgabe 1851, Text, Uebersetzung und Commentar, Bd. 1 und 2, 1854 f.), des Aeschines und ausgewählter Reden des Demosthenes (1854—61, beide in der Engelmann'schen Sammlung) und durch seine seinen Untersuchungen über den hiatus in der griechischen Rednern (1841). Sein Hauptwerk ist das Wörterbuch der griechischen Eigennamen, 1863—70 (2 starke Bände), worin der erste Versuch einer Verdeutschung derselben gemacht wurde. Außerdem noch: Berggeschichten vom aufkommen des sächsischen Bergbaus und die während seiner Haft verfaßte Geschichte Freibergs und seines Bergbaus (1853, 2 Bde.). G. Benseler (Sohn) in der Vorrede zum Wörterbuch der griechischen
Eigennamen und nach schriftlichen Mittheilungen desselben. H. Allgemeine Deutsche Biographie, "Balde ~ Bode", Bd. 2, Leipzig 1875, p. 341. Bibliografie: Další odkazy: Friedrich August Eckstein, Nomenclator Philologorum, Teubner, Leipzig 1871, I 82, 120–121. |